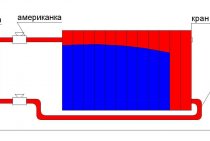Kohle abbauen
Die Methoden des Kohlebergbaus hängen von der Tiefe ihres Vorkommens ab. Die Entwicklung erfolgt offen in Kohlebergwerken, wenn die Tiefe des Kohleflözes hundert Meter nicht überschreitet. Es gibt auch häufige Fälle, in denen es bei einer immer weiter zunehmenden Vertiefung einer Kohlegrube weiter vorteilhaft ist, eine Kohlelagerstätte unter Tage zu erschließen. Minen werden verwendet, um Kohle aus großen Tiefen zu fördern. Die tiefsten Minen in der Russischen Föderation fördern Kohle aus einer Tiefe von etwas mehr als eintausendzweihundert Metern.
Bei der konventionellen Minenproduktion werden etwa 40 % der Kohle nicht abgebaut. Durch den Einsatz neuer Abbaumethoden – Strebbau – können Sie mehr Kohle fördern.
Neben Kohle enthalten kohlehaltige Lagerstätten viele Arten von Georessourcen, die für Verbraucher von Bedeutung sind. Dazu gehören Wirtsgesteine als Rohstoffe für die Bauindustrie, Grundwasser, Flözgas, Seltene- und Spurenelemente, einschließlich wertvoller Metalle und deren Verbindungen. Einige Kohlen sind zum Beispiel mit Germanium angereichert.
erreichte 2013 mit 8254,9 Millionen Tonnen seinen Höchststand.
Kohle Bildung
Zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten in der geologischen Vergangenheit der Erde existierten dichte Wälder in Feuchtgebieten im Tiefland. Aufgrund natürlicher Prozesse wie Überschwemmungen wurden diese Wälder unter der Erde begraben. Als die Erdschicht über ihnen zunahm, nahm der Druck zu. Die Temperatur stieg auch, als es sank. Unter solchen Bedingungen wurde das Pflanzenmaterial vor biologischem Abbau und Oxidation geschützt. Der von Pflanzen in riesigen Torfgebieten gespeicherte Kohlenstoff wurde schließlich von Sedimenten bedeckt und tief begraben. Unter hohem Druck und hoher Temperatur wird abgestorbene Vegetation nach und nach in Kohle umgewandelt. Da Holzkohle hauptsächlich aus Kohlenstoff besteht, wird die Umwandlung von abgestorbener Vegetation in Holzkohle als Karbonisierung bezeichnet.
Kohle entsteht, wenn sich verrottendes Pflanzenmaterial schneller ansammelt, als es bakteriell zersetzt werden kann. Die ideale Umgebung dafür wird in Sümpfen geschaffen, wo stehendes, sauerstoffarmes Wasser die lebenswichtige Aktivität von Bakterien verhindert und so die Pflanzenmasse vor der vollständigen Zerstörung schützt. In einem bestimmten Stadium des Prozesses verhindern die freigesetzten Säuren eine weitere bakterielle Aktivität. Das ist wie Torf - das Ausgangsprodukt für die Bildung von Kohle. Wird er dann unter anderen Sedimenten begraben, wird der Torf komprimiert und unter Verlust von Wasser und Gasen in Kohle umgewandelt.
Unter dem Druck von 1 km dicken Sedimentschichten wird aus einer 20 m hohen Torfschicht eine 4 m dicke Braunkohleschicht gewonnen. Wenn die Tiefe des Pflanzenmaterials drei Kilometer erreicht, verwandelt sich dieselbe Torfschicht in eine 2 Meter dicke Kohleschicht. In größerer Tiefe, etwa sechs Kilometer, und bei höherer Temperatur wird aus einer 20 Meter dicken Torfschicht eine 1,5 Meter dicke Anthrazitschicht.
Für die Bildung von Kohle ist eine reichliche Ansammlung von Pflanzenmasse notwendig. In alten Torfmooren hat sich ab der Devonzeit (vor etwa 400 Millionen Jahren) organisches Material angesammelt, aus dem sich ohne Zugang zu Sauerstoff fossile Kohlen gebildet haben. Die meisten kommerziellen fossilen Kohlevorkommen stammen aus dieser Zeit, obwohl es auch jüngere Vorkommen gibt. Das Alter der ältesten Kohlen wird auf etwa 300-400 Millionen Jahre geschätzt.
Die Bildung großer Kohlemengen hörte höchstwahrscheinlich nach dem Auftreten von Pilzen auf, da die Weißfäule von Pilzen Lignin vollständig zersetzt.
Die weiten, flachen Meere des Karbons boten ideale Bedingungen für die Kohlebildung, obwohl Kohlen aus den meisten geologischen Perioden bekannt sind.Die Ausnahme ist die Kohlelücke während des Perm-Trias-Aussterbens, wo Kohle selten ist. Es wird angenommen, dass die Kohle, die in den präkambrischen Schichten vor den Landpflanzen gefunden wurde, aus den Überresten von Algen stammt.
Infolge der Bewegung der Erdkruste erfuhren Kohleflöze eine Hebung und Faltung. Im Laufe der Zeit wurden die angehobenen Teile durch Erosion oder Selbstentzündung zerstört, während die abgesenkten in weiten flachen Becken erhalten blieben, in denen Kohle mindestens 900 Meter über der Erdoberfläche liegt. Die Bildung der dicksten Kohleflöze ist mit Gebieten der Erdoberfläche verbunden, auf deren Gebiet Abflüsse von erheblichen Mengen bituminöser Massen aufgetreten sind, wie zum Beispiel in Hat Creek (englisch) russisch. (Kanada) erreicht die Gesamtdicke des Kohleflözpakets 450 m.
Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit der Bergleute
Fossile Kohle enthält schädliche Schwermetalle wie Quecksilber und Cadmium (Konzentration von bis zu 0,0001 bis 0,01 Gew.-%)[Quelle nicht angegeben 2077 Tage].
Beim untertägigen Kohlebergbau kann der Staubgehalt der Luft den MPC um das Hundertfache überschreiten. Unter den Arbeitsbedingungen, die in den Minen herrschen, ist das kontinuierliche Tragen von Atemschutzmasken praktisch unmöglich (bei jeder starken Verschmutzung erfordern sie einen schnellen Wechsel, um neue Atemschutzmasken zu reinigen, sie erlauben keine Kommunikation usw.), was ihre Verwendung nicht zulässt als Mittel zur zuverlässigen Vorbeugung von irreversiblen und unheilbaren Berufskrankheiten - Silikose, Pneumokoniose (usw.). Um die Gesundheit von Bergleuten und Arbeitern von Kohleverarbeitungsunternehmen in den Vereinigten Staaten zuverlässig zu schützen, werden daher wirksamere Mittel des kollektiven Schutzes eingesetzt.
Klassifizierung, Typen
Kohle wird in glänzend, halbglänzend, halbmatt und matt unterteilt. Glänzende Kohlesorten sind in der Regel aufgrund des geringen Anteils an mineralischen Verunreinigungen aschearm.
Unter den Strukturen der organischen Substanz von Kohle werden 4 Typen (Telinit, Posttelinit, Precolinit und Colinit) unterschieden, die aufeinanderfolgende Stadien eines einzigen Prozesses der Zersetzung von Ligninen - Zellulosegeweben - sind. Zu den genetischen Gruppen der Steinkohle wird neben diesen vier Typen zusätzlich die Leuptinitkohle gezählt. Jede der fünf genetischen Gruppen nach der Stoffart der Kohlemikrokomponenten wird in entsprechende Klassen eingeteilt.
Es gibt viele Arten von Kohleklassifikationen: nach stofflicher Zusammensetzung, petrografischer Zusammensetzung, genetisch, chemisch-technologisch, industriell und gemischt. Genetische Klassifikationen charakterisieren die Bedingungen der Kohleakkumulation, reale und petrographische - ihre stoffliche und petrographische Zusammensetzung, chemisch-technologische - die chemische Zusammensetzung der Kohle, die Prozesse der Bildung und industriellen Verarbeitung, industriell - technologische Gruppierung von Kohlearten je nach den Anforderungen der Industrie. Kohleklassifikationen in Flözen werden verwendet, um Kohlevorkommen zu charakterisieren.
Industrielle Klassifizierung von Kohle
Die industrielle Klassifizierung von Steinkohle in den einzelnen Ländern basiert auf verschiedenen Parametern der Eigenschaften und Zusammensetzung von Kohle: In den USA wird Steinkohle nach der Verbrennungswärme, dem Gehalt an gebundenem Kohlenstoff und dem relativen Gehalt an flüchtigen Stoffen klassifiziert, in Japan - nach der Verbrennungswärme, den sogenannten Brennstoffkoeffizienten und der Stärke von Koks oder der Unfähigkeit zu verkoken. In der UdSSR fungierte die sogenannte Donezk-Klassifikation, die im Jahr von V. S. Krym entwickelt wurde, als wichtigste industrielle Klassifikation. Es wird manchmal als "gebrandmarkt" bezeichnet und ist gleichzeitig genetisch, da die zugrunde gelegten Veränderungen in den Eigenschaften der Kohle ihren Zusammenhang mit der genetischen Entwicklung der organischen Substanz der Kohle widerspiegeln.
Einlagen
| Das Land | Kohle | Braunkohle | Gesamt | % |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 111 338 | 135 305 | 246 643 | 27,1 |
| Russland | 49 088 | 107 922 | 157 010 | 17,3 |
| China | 62 200 | 52 300 | 114 500 | 12,6 |
| Indien | 90 085 | 2360 | 92 445 | 10,2 |
| Australien | 38 600 | 39 900 | 78 500 | 8,6 |
| Südafrika | 48 750 | 48 750 | 5,4 | |
| Ukraine | 16 274 | 17 879 | 34 153 | 3,8 |
| Kasachstan | 28 151 | 3128 | 31 279 | 3,4 |
| Polen | 14 000 | 14 000 | 1,5 | |
| Brasilien | 10 113 | 10 113 | 1,1 | |
| Deutschland | 183 | 6556 | 6739 | 0,7 |
| Kolumbien | 6230 | 381 | 6611 | 0,7 |
| Kanada | 3471 | 3107 | 6578 | 0,7 |
| Tschechien | 2094 | 3458 | 5552 | 0,6 |
| Indonesien | 740 | 4228 | 4968 | 0,5 |
| Truthahn | 278 | 3908 | 4186 | 0,5 |
| Madagaskar | 198 | 3159 | 3357 | 0,4 |
| Pakistan | 3050 | 3050 | 0,3 | |
| Bulgarien | 4 | 2183 | 2187 | 0,2 |
| Thailand | 1354 | 1354 | 0,1 | |
| Nordkorea | 300 | 300 | 600 | 0,1 |
| Neuseeland | 33 | 538 | 571 | 0,1 |
| Spanien | 200 | 330 | 530 | 0,1 |
| Zimbabwe | 502 | 502 | 0,1 | |
| Rumänien | 22 | 472 | 494 | 0,1 |
| Venezuela | 479 | 479 | 0,1 | |
| Gesamt | 478 771 | 430 293 | 909 064 | 100,0 |
Steinkohle konzentriert sich im Kohlebecken von Donezk und im Kohlebecken von Lemberg-Wolyn (Ukraine); Karaganda (Kasachstan); Süd-Jakutsk, Minusinsk, Bureinsky, Tungussky, Lensky, Taimyrsky (Russland); Appalachen, Pennsylvanian (Nordamerika), Niederrhein-Westfalen (Ruhr - Deutschland); Oberschlesien, Ostrava-Karvinsky (Tschechische Republik und Polen); Shanxi-Becken (China), Südwalisisches Becken (Großbritannien).
Unter den größten Kohlebecken, deren industrielle Entwicklung im 18.-19. Jahrhundert begann, sind Mittelengland, Südwales, Schottland und Newcastle (Großbritannien) hervorzuheben; Westfälisches (Ruhr) und Saarbrücker Becken (Deutschland); Einlagen von Belgien und Nordfrankreich; Becken von Saint-Etienne (Frankreich); Schlesien (Polen); Donezker Becken (Ukraine).
Ausbildung
Kohle entsteht aus den Zersetzungsprodukten der organischen Reste von Pflanzen, die unter hohem Druck der umgebenden Gesteine der Erdkruste und relativ hohen Temperaturen Veränderungen (Metamorphose) erfahren haben.
Wenn die kohleführende Schicht unter Bedingungen zunehmenden Drucks und steigender Temperatur in eine Tiefe eingetaucht wird, findet eine konsequente Umwandlung der organischen Masse statt, eine Änderung ihrer chemischen Zusammensetzung, ihrer physikalischen Eigenschaften und ihrer molekularen Struktur. All diese Umwandlungen werden als „regionale Kohlemetamorphose“ bezeichnet. Auf der letzten (höchsten) Stufe der Metamorphose verwandelt sich Kohle in Anthrazit mit einer ausgeprägten Kristallstruktur von Graphit. Neben der regionalen Metamorphose finden manchmal (seltener) Umwandlungen unter dem Einfluss von Wärme aus Eruptivgestein statt, das sich neben kohlehaltigen Schichten befindet (darüber oder darunter) - thermische Metamorphose, sowie direkt in Kohleflözen - Kontaktmetamorphose. Eine Zunahme des Metamorphosegrades in der organischen Substanz der Kohle wird durch eine stetige Zunahme des relativen Kohlenstoffgehalts und eine Abnahme des Sauerstoff- und Wasserstoffgehalts verfolgt. Die Ausbeute an flüchtigen Stoffen nimmt stetig ab (von 50 auf 8 % bezogen auf trockenen aschefreien Zustand), die Verbrennungswärme, die Sinterfähigkeit und die physikalischen Eigenschaften der Kohle ändern sich ebenfalls. Insbesondere Glanz, Reflexionsvermögen, Schüttdichte der Kohle und andere Eigenschaften ändern sich linear. Andere wichtige physikalische Eigenschaften (Porosität, Dichte, Verbackung, Verbrennungswärme, elastische Eigenschaften usw.) ändern sich nach ausgeprägten parabolischen oder gemischten Gesetzen.
Als optisches Kriterium für das Stadium der Kohlemetamorphose wird der Reflektivitätsindex verwendet; Es wird auch in der Erdölgeologie verwendet, um das Stadium der katagenen Umwandlungen der Sedimentschichten zu bestimmen. Das Reflexionsvermögen beim Eintauchen in Öl (R0) steigt stetig von 0,5–0,65 % für Kohle der Sorte D auf 2–2,5 % für Kohle der Sorte T.
Die Dichte und Porosität von Kohle hängen von der petrographischen Zusammensetzung, der Menge und Art der mineralischen Verunreinigungen und dem Metamorphosegrad ab. Die Komponenten der Fusinitgruppe zeichnen sich durch die höchste Dichte (1300–1500 kg/m³) und die niedrigste (1280–1300 kg/m³) durch die Vitrinitgruppe aus. Die Dichteänderung mit zunehmendem Metamorphosegrad erfolgt nach einem parabolischen Gesetz mit einer Inversion in der Übergangszone zur Fettgruppe; bei aschearmen Ausprägungen nimmt sie von der Kohlesorte D bis zur Sorte Zh im Mittel von 1370 auf 1280 kg/m³ ab und steigt dann sukzessive für die Kohlesorte T bis auf 1340 kg/m³ an.
Auch die Gesamtporosität der Kohle ändert sich nach extremen Gesetzen; für Donezk-Kohle der Sorte D beträgt sie 14–22 %, Kohle der Sorte K 4–8 % und steigt (wahrscheinlich aufgrund von Lockerungen) auf 10–15 % für Kohle der Sorte T.Poren in Kohle werden in Makroporen (durchschnittlicher Durchmesser 500 × 10–10 m) und Mikroporen (5–15 × 10–10 m) unterteilt. Die Lücke wird von Mesoporen besetzt. Die Porosität nimmt mit zunehmendem Metamorphosestadium ab. Die endogene (während der Kohlebildung entstandene) Frakturierung, die durch die Anzahl der Risse pro 5 cm glänzender Kohle geschätzt wird, hängt vom Stadium der Kohlemetamorphose ab: Sie steigt auf 12 Risse während des Übergangs von Braunkohle zu Langflamme Kohle und hat ein Maximum von 35–60 für Kokskohle und nimmt sukzessive auf 12–15 Risse im Übergang zu Anthrazit ab. Dem gleichen Änderungsmuster in den elastischen Eigenschaften von Kohle sind der Elastizitätsmodul, die Poisson-Zahl, der Schermodul (Schermodul) und die Ultraschallgeschwindigkeit untergeordnet. Die mechanische Festigkeit von Steinkohle ist durch ihre Brechbarkeit, Sprödigkeit und Härte sowie die temporäre Druckfestigkeit gekennzeichnet.
Verwendung
Steinkohle wird als technologischer, energietechnologischer und energetischer Rohstoff, bei der Herstellung von Koks und Halbkoks im Zusammenhang mit der Herstellung einer Vielzahl von chemischen Produkten daraus (Naphthalin, Phenol, Pech etc.), auf deren Grundlage Düngemittel, Kunststoffe, Kunstfasern, Lacke, Farben und so weiter.
Einer der vielversprechendsten Bereiche für die Verwendung von Kohle ist die Verflüssigung (Hydrierung von Kohle) zur Herstellung von flüssigem Kraftstoff. Es gibt verschiedene Regelungen zur nichtenergetischen Nutzung von Steinkohle auf der Grundlage thermochemischer, chemischer und anderer Verarbeitung mit dem Ziel ihrer vollständigen integrierten Nutzung und der Gewährleistung des Umweltschutzes.